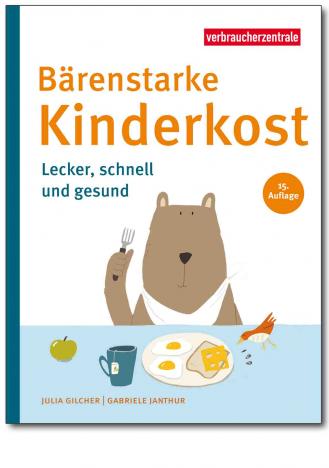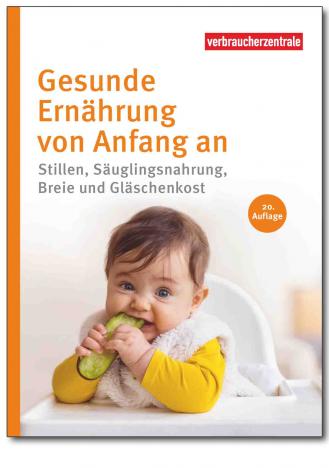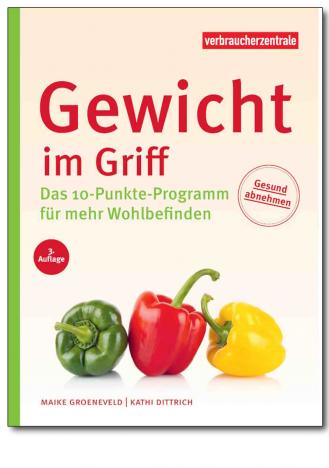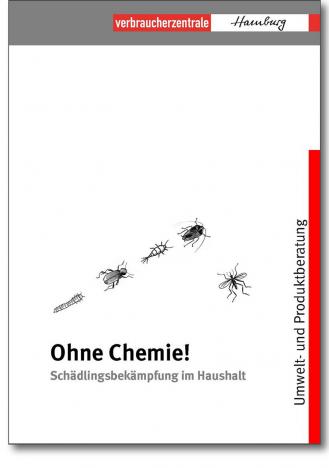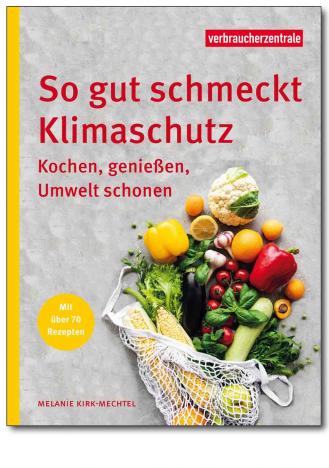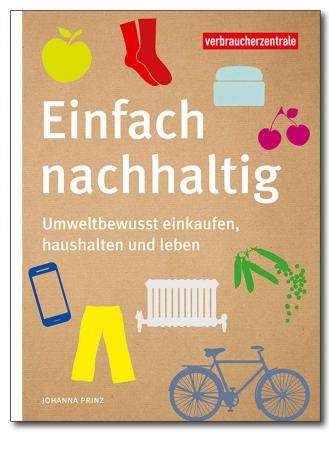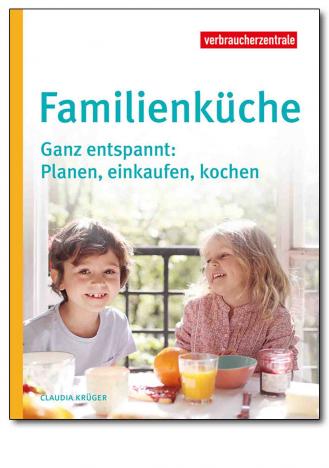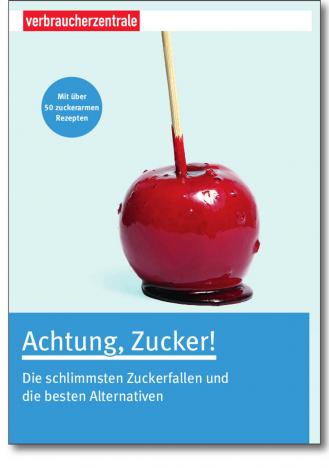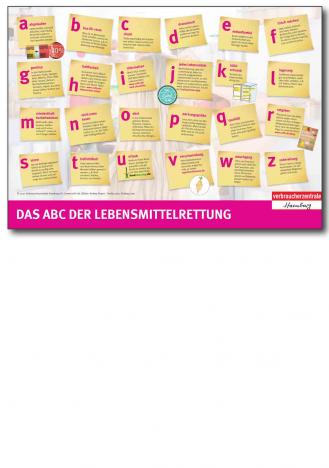Pflanzliche Produktbezeichnungen: Was spricht für „Veggie-Burger“ & Co.?

Das Wichtigste in Kürze
- Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „veganes Steak“ helfen Verbraucherinnen und Verbrauchern, Geschmack, Verwendung und Art des Produkts auf einen Blick zu erkennen.
- Ein Verbot etablierter pflanzlicher Produktnamen würde die Orientierung erschweren und keinen Beitrag zum Verbraucherschutz leisten.
- Verwirrung entsteht eher an anderer Stelle.
Das Europäische Parlament hat sich Mitte Oktober mehrheitlich dafür ausgesprochen, Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Veggie-Wurst“ zu verbieten. Final entschieden ist aber noch nichts. Das Verbot kann nur wirksam werden, wenn auch eine Mehrheit der 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmt. Die Verbraucherzentrale sieht das Vorhaben kritisch.
Viele Menschen greifen aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen zu pflanzlichen Ersatzprodukten, ohne auf gewohnte Gerichte verzichten zu wollen.
Können die pflanzlichen Alternativen zu diesen Gerichten nicht vergleichbar beschrieben werden, kann dies gegebenenfalls auch den Einsatz solcher Produkte und eine etwaige Ernährungsumstellung auf vermehrt pflanzlicher Basis erschweren.
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen setzt sich grundsätzlich für klare und verständliche Lebensmittelkennzeichnungen ein. Nach unserer Einschätzung tragen Begriffe wie „Veggie-Burger“ oder „veganes Steak“ dazu bei, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sofort erkennen, wie die Produkte zu verwenden sind und was sie geschmacklich erwartet.
Solange eindeutig angegeben ist, dass ein Produkt vegetarisch oder vegan ist, sorgen diese Begriffe für mehr Transparenz anstatt für Verwirrung.
Verwirrung eher bei Haferdrink Leberkäse und Müsliriegeln
Irritationen treten eher an anderer Stelle auf – etwa bei Begriffen wie „Haferdrink“ statt „Hafermilch“. Der Begriff Milch ist ebenso wie Joghurt, Sahne, Butter und Käse gesetzlich geschützt (VO (EU) 1308/2013, Käse-Verordnung). Er darf nur für Produkte verwendet werden, die aus dem Euter von Säugetieren wie Kuh, Büffel, Schaf oder Ziege gewonnen werden. Daher sind Bezeichnungen wie Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch oder Sojamilch nicht erlaubt. Der Begriff "Kokosmilch" hingegen ist (wie auch Kakao- oder Erdnussbutter) aufgrund einer Ausnahmeregelung zulässig. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das eher unlogisch.
Auch bei tierischen Produkten gibt es Verwirrung: Die Bezeichnung „Leberkäse“ beispielsweise ist rechtlich erlaubt, obwohl das Produkt keinen Käse enthält. Zwar dürfen Anbieter den Begriff „Käse“ nur dann verwenden, wenn tatsächlich Käse enthalten ist. Es gibt jedoch Ausnahmen für Erzeugnisse, deren Art und Name aufgrund ihrer traditionellen Verwendung allgemein bekannt sind. Diese Ausnahmen sind in einer Liste der Europäischen Kommission festgelegt – und dazu gehört auch der Leberkäse.
Der Name geht auf die traditionelle Herstellung zurück und erinnert an die Form eines klassischen Käselaibs. Leberkäse wird aus fein zerkleinertem Rind- und Schweinefleisch hergestellt und enthält teilweise Leber. Bayerischer Leberkäse enthält in der Regel keine Leber, während Stuttgarter Leberkäse mindestens fünf Prozent Leber aufweist. Käse ist im Leberkäse jedoch nie enthalten.
Obwohl pflanzliche Produkte in der Regel deutlich als vegan oder vegetarisch gekennzeichnet sind, ist das bei tierischen Bestandteilen nicht der Fall. Auch dies sorgt teilweise für Verärgerung: Ein Beispiel: Ein Müsliriegel mit Milchpulver ist vermeintlich pflanzlich, enthält aber tierische Zutaten.
Statt neuer Verbote ist es entscheidend, dass Bezeichnungen verständlich bleiben – unabhängig davon, ob ein Produkt pflanzlich oder tierisch ist.